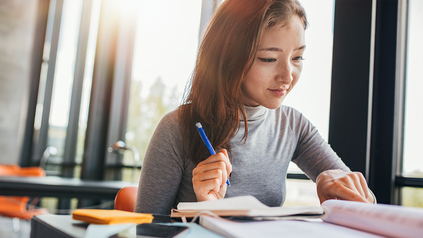Gewaltfreie Kommunikation

Kommunikation läuft nicht immer reibungslos ab, denn in dem, was wir sagen und wie wir es sagen, kann ziemlich viel mitschwingen: unsere Stimmung, Emotionen, Erfahrungen, Werte, persönlichen Bezüge zum Gegenüber, Gedanken, Einstellungen und subjektive Wahrnehmungen. Miteinander reden und sich austauschen ist also eigentlich viel komplizierter als man auf den ersten Blick vielleicht meint.
Kein Wunder also, dass wir mal was sagen, beim Gegenüber aber nicht ankommt, was wir meinen – oder andersrum. Nicht selten fühlt man selbst oder der/die Kommunikationspartner:in sich dann auf den Schlips getreten, Probleme vorprogrammiert. Ein guter Weg Missverständnissen vorzubeugen kann die gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK, sein. Mit ihr lassen sich Gespräch von Anfang bis Ende in ein positives Setting lenken.
Was die GFK genau ist, wie du sie für deinen Alltag, im Studium, später im Berufsleben und auch privat nutzen kannst, um deine kommunikativen Skills auszubauen? Wir verraten es dir.
Was ist gewaltfreie Kommunikation, einfach erklärt?
Bei der GFK handelt es sich um eine Art des Sprechens, die auf gegenseitigen Respekt, Achtsamkeit und Empathie sich selbst und den Gesprächspartner:innen gegenüber beruht. Ziel ist es, durch klare, aber auch einfühlsame Äußerungen eine Kommunikationsbasis zu schaffen, die Konflikte auflöst oder bestenfalls gar nicht erst zustande kommen lässt. Der Ansatz wurde von Marshall Rosenberg in den 1970er und 1980er Jahren entwickelt und wird bis heute weiterentwickelt.
Good to know: Was ist gewaltvolle Kommunikation?
Dabei handelt es sich um weniger respektvolle bis respektlose Äußerungen wie bspw. bei Vorwürfen, Beschuldigungen, Drohungen, Beleidigungen und beim Nörgeln, Pauschalisieren oder Lästern.
Wortwahl und Intonation sind dabei eher negativ, also bspw. „wenn du nicht sofort, dann …“; „du bist schuld, dass …“. Rationale Erklärungen und konstruktive Lösungsansätze werden dabei eben nicht gegeben. Das macht diese Art der Kommunikation so gewaltvoll.
Wie funktioniert gewaltfreie Kommunikation?
Der Ansatz lässt sich in jeder Gesprächssituation in 4 Kommunikationsschritte unterteilen:
- Beobachtungen formulieren: Was ist der Sachverhalt, das Wahrgenommene? Im ersten Schritt solltest du das möglichst neutral und wertungsfrei ansprechen.
- Eigene Gefühle äußern: Welche Emotionen löst der Sachverhalt in dir aus? Beschreibe sie.
- Bedürfnisse kommunizieren: Was möchtest du? Was ist das Ziel des Gesprächs und wie kann es erreicht werden?
- Bitte ausformulieren: Adressiere eine konkrete Bitte an dein Gegenüber, um den Sachverhalt aufzulösen.
Geht man jetzt als Beispiel das leidige WG-Putz-Thema an, wäre ein möglicher Gesprächsaufbau, nach den oben genannten 4 Schritten der GFK, wie folgt:
- Beobachtung: „Gerade ist es ziemlich unordentlich in unserer WG.“
- Gefühl: „Ich fühle mich deswegen hier gerade nicht mehr wohl.“
- Bedürfnis: „Mir wäre es wichtig, dass wir das Chaos beseitigen.“
- Bitte: „Könntest du mir bitte dabei helfen? Zu zweit geht es schneller.“
Wo wird gewaltfreie Kommunikation eingesetzt?
Die GFK kann grundlegend in allen Bereichen der menschlichen Kommunikation eingesetzt werden, v.a. ist sie aber hier zu finden:
- Krisen- und Konfliktmanagement
- Gruppentherapieformen, wie Paar- oder Familientherapien
- Pädagogik
- Psychologischer oder allg. medizinischer Support
- Pflege und Betreuung
- Integration
Wann ist gewaltfreie Kommunikation sinnvoll?
Eigentlich immer und überall, denn sie kann dabei helfen, Missverständnisse gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und das ist in Arbeitsgesprächen mit Kolleg:innen oder Vorgesetzten genauso praktisch wie bei Gruppenarbeiten oder Sprechstunden an der Uni. Just give it a try!
Spätestens, wenn du sprachlich gar nicht mehr weiterkommst, bei Schwierigkeiten, Problemen – also für Klärungsgespräche – solltest du auf die GFK zurückgreifen.
Wie lernt man gewaltfreie Kommunikation?
Jede:r kann lernen, gewaltfrei zu kommunizieren. Dafür solltest du dich im ersten Schritt mit dir und deinen Emotionen und Bedürfnissen auseinandersetzen, denn nur, wenn du dich selbst kennst und weißt, wie du tickst, kannst du das anderen gegenüber ausdrücken.
Auch ein Mindestmaß an Empathie ist für die GFK notwendig. Neben deinen Gefühlen und Bedürfnissen geht es ja eben auch um die von deine:r Gesprächspartner:in. Versuch dich also ab und zu mal in die andere Person reinzuversetzen, hör genau hin, was sie sagt und zeige Verständnis.
Der Rest ist Übung: übe, mit dir selbst und anderen respektvoll und verständnisvoll umzugehen und übe deine Ausdrucksweise. Nicht nur der Ton, also wie du Dinge sagst, spielen dabei eine große Rolle, sondern auch deine Wortwahl, also was genau du sagst. Im nächsten Punkt haben wir dir dafür ein paar Formulierungsbeispiele zusammengefasst.
Welche Beispiele gibt es gewaltfreie Kommunikation?
Sprache ist ein unglaublich komplexes und breites Feld – natürlich können wir dir nicht für jede Situation die perfekte Lösung präsentieren. Ein paar Ideen, wie du Äußerungen, die jede:r bekannt vorkommen dürften, so umformulierst, dass sie gewaltfrei werden, können wir dir aber schon mitgeben.
- „Du hast nicht ...: den Müll rausgetragen/den Termin klargemacht“ oder Ähnliches – solche Aussagen führen eig. immer dazu, dass das Gegenüber sich angegriffen fühlt. Versuch entweder eine Frage daraus zu machen, wertfrei, also „Hast du den Müll rausgetragen?“ oder gleich die Schritte der GFK durchzuspielen: „Der Müll steht im Flur (Beobachtung). Das nervt mich, weil ich dich heute Morgen gebeten habe, ihn mitzunehmen (Emotion). Ich finde es nicht gut, wenn der so lange im Flur steht (Bedürfnis). Könntest du/wir ihn bitte noch runterbringen?“ (Bitte).
- „Ich habe es satt, dass ...: du immer unpünktlich bist/du meinen Geburtstag ständig vergisst“ oder Ähnliches – dadurch springst du ohne Erklärung und Vorwarnung gleich mitten ins Gespräch und in die Konfrontation. Besser wäre erstmal darauf einzugehen, was los ist, also bspw.: „Ich warte seit 10 Minuten auf dich. Leider bist du öfter spät dran, was mich wirklich traurig macht. Kannst du bitte versuchen pünktlich zu sein oder Bescheid zu geben, wenn du dich verspätest?“.
- „Wenn du nicht sofort, dann ...“: Drohungen und Ultimaten sind wirklich schlecht, denn sie weisen darauf hin, dass eine offensichtlich notwendige Kommunikation nicht rechtzeitig stattgefunden hat und bei dir das Fass schon übergelaufen ist. Versuch trotzdem ruhig zu bleiben und anstatt zu drohen einen konstruktiven Vorschlag zu bringen, sowas wie: „Können wir versuchen, dass .../ Wäre es in Ordnung, dass du bitte ...?“ Du musst übrigens nicht die perfekte Lösung parat haben, schon ein „Können wir bitte über Thema XY reden und gemeinsam eine Lösung finden“ ist definitiv besser als ein Ultimatum!
- „Du bist schuld, dass ...: ich meinen Bus verpasst habe/Freund XY sauer auf mich ist“ oder sonstiges in die Richtung ist nichts weiter als ein Vorwurf, was auch eher gewaltvoll und kontraproduktiv ist. Eine Mischung aus Bedürfnis und Bitte äußern wäre hier hilfreicher, sowas wie: „Ich hab Freund XY wirklich sehr gerne, könntest du beim nächsten Mal bitte ...“ So drückst du nicht nur aus, was dir wichtig ist, sondern gibts deinem Gegenüber auch die Chance zukünftig besser zu agieren.
Kostenlose Übungen gefällig?
Wenn du deine gewaltfreie Kommunikation und einen achtsamen Umgang mit dir und anderen verbessern möchtest, kannst du dir diverse Unterlagen, wie Übungshefte, kostenlos von gewatlfrei-uebungen.de herunterladen.
(fachverband-gfk/gewaltfrei-kommunizieren.hamburg/institut-bildung-coaching/psychologie-heute/SALI)