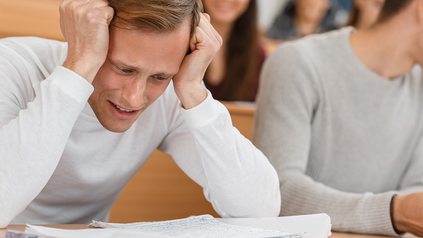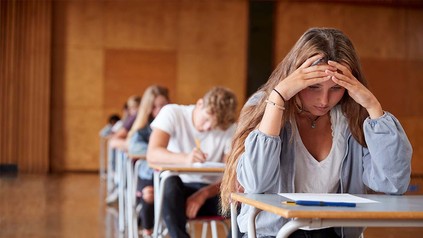Was Studierende bei Prüfungsanfechtungen beachten sollten

Mit einem Widerspruch, der fest im Hochschulrecht verankert ist, kannst du Prüfungsergebnisse anfechten. Klingt formell, ist aber oft der erste Schritt zu einer fairen Neubewertung. Um im Ernstfall optimal vorbereitet zu sein, ist es eine gute Idee, sich schon vor der Aufnahme des Studiums mit den eigenen Rechten und Pflichten zu befassen.
Wann ein Einspruch Sinn ergibt
Nicht jede schlechte Note rechtfertigt einen Widerspruch. Doch es gibt klare Fälle, in denen eine Prüfungsanfechtung sinnvoll ist. Dazu gehören:
- Verfahrensfehler: Wenn Prüfungsaufgaben falsch gestellt waren oder gegen die Prüfungsordnung verstoßen wurde (zum Beispiel durch unzulässige Hilfsmittel oder eine fehlende Aufsicht), liegen Verfahrensfehler vor.
- Bewertungsfehler: Wenn die Bewertung objektiv nicht nachvollziehbar ist, zum Beispiel weil Punkte falsch addiert oder Argumentationen ignoriert wurden.
- Rechtswidrige Bedingungen: Diese liegen zum Beispiel vor, wenn ein Nachteilsausgleich nicht berücksichtigt oder eine Prüfungsunfähigkeit nicht anerkannt wurde.
Eine Untersuchung von Bäumler/Krüger (2021) zu Prüfungsanfechtungen in NRW zeigt: In rund 18 % der untersuchten Fälle kam es zu Änderungen der Bewertung oder zur Wiederholung der Prüfung.
Erfolgversprechend sind vorrangig Fälle mit dokumentierten Mängeln, darunter E-Mails, in denen Dozierende falsche Informationen zur Klausur vorgaben. Bist du unsicher, ob ein Fehler vorliegt, ziehe frühzeitig die Unterstützung durch einen Anwalt in Betracht.
Bei engen Fristen oder komplexen Fällen ist professionelle Hilfe oft die einzig sinnvolle Option. Fachanwälte kennen sich mit dem Hochschulrecht hervorragend aus und sagen Studierenden und deren Eltern, ob eine Prüfungsanfechtung Aussicht auf Erfolg hat.
Fristen, Formalien, Formulierungen
Zeit ist ein kritischer Faktor bei einer Anfechtung. Der Widerspruch gegen eine Prüfungsentscheidung muss in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids bei der Hochschule eingehen. Die genaue Frist steht im Bescheid oder in der Prüfungsordnung. Es ist unerlässlich, dass ein entsprechender Widerspruch formal korrekt gestellt wird. In den Widerspruch gehören dazu:
- Vollständige Absenderdaten
- Prüfungsbezeichnung, Datum, ggf. Matrikelnummer
- Klare Aussage: „Hiermit lege ich Widerspruch gegen die Bewertung der Prüfung XY ein.“
- Begründung (konkret, sachlich, belegt)
- Unterschrift (auch bei E-Mail-Widerspruch, oft als Scan notwendig)
Ein formloser Widerspruch reicht zunächst, ausschlaggebend ist nur, dass er fristgerecht eingeht. Die Begründung darf meist nachgereicht werden. Einige Hochschulen stellen hierfür eigene Onlineportale zur Verfügung.
Wichtig: Bist du dir nicht sicher, solltest du die Prüfungsordnung genau lesen oder im Prüfungsamt nachfragen. Das gilt sowohl für schriftliche als auch für mündliche Prüfungen.
Was danach passiert
Nach Eingang prüft die Hochschule, ob der Widerspruch zulässig und begründet ist. Dafür wird oft das Prüfungsprotokoll herangezogen oder ein Zweitgutachten angefordert. Die Prüfer:innen werden in der Regel gebeten, die Bewertung zu erläutern.
Daraufhin sind folgende Szenarien möglich:
- Ablehnung: Der Widerspruch wird als unbegründet zurückgewiesen.
- Abhilfe: Die Bewertung wird angepasst oder die Prüfung annulliert.
- Teilweise Abhilfe: Einzelne Punkte werden neu bewertet.
Bleibt der Widerspruch ohne Erfolg, kannst du, ebenso wie bei einer Studienplatzklage, innerhalb eines Monats Klage beim Verwaltungsgericht einreichen. Hier wird es juristisch und spätestens jetzt ist eine anwaltliche Begleitung fast unumgänglich.
Tipps aus der Praxis
Einige praktische Hinweise helfen, die Erfolgschancen eines Prüfungswiderspruchs zu erhöhen. Zunächst solltest du unbedingt von deinem Recht auf Akteneinsicht Gebrauch machen. So erhältst du Zugang zu deiner Prüfungsakte, inklusive aller Korrekturen, Randbemerkungen und interner Notizen.
Wichtig: Bleib in deiner Argumentation sachlich und präzise. Emotionale Formulierungen oder bloße Unzufriedenheit mit der Note führen selten zum Erfolg; erfolgversprechend sind hingegen nachvollziehbare, belegbare Argumente.
Falls du den Eindruck hast, dass auch andere Studierende von demselben Fehler betroffen sind, ist ein Austausch sinnvoll. Gemeinsam erhobene Widersprüche oder Hinweise auf systematische Probleme sensibilisieren die Prüfungskommission nämlich zusätzlich.
Sichere zusätzlich unbedingt Belege, darunter Screenshots von Ankündigungen, relevante E-Mails oder Handouts, denn sie helfen, widersprüchliche Abläufe oder fehlerhafte Vorgaben nachzuweisen. Und schließlich gilt: Reagiere frühzeitig. Je schneller du dich informierst und aktiv wirst, desto besser hältst du Fristen ein und bereitest dich gezielt vor.
(Frank Schneider/SALI)